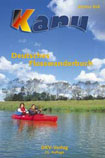Historisches zum Deutschen Kanu-Verband
Gründung
Der DKV wurde 1914 gegründet. 1914? Richtig, da war doch was, da war erster Weltkrieg. Da gründet man doch keinen Verband! Unglücklich war der Gründungszeitpunkt schon. Verbandsarbeit unter Kriegsbedingungen ist eigentlich ein Unding, fand aber in engem Rahmen doch statt.
Das Gründungsdatum, der 15.März 1914, lag natürlich vor dem Kriegsausbruch. Gemessen am allgemeinen Vereinsleben in der Gesellschaft waren die Kanusportler etwas spät mit ihrer Gründung am Werk. Einen Ruderverband gab es längst und in dessen Zeitschrift wurde der Gründungsaufruf veröffentlicht. Man geht von 9 Vereinen und etlichen Einzelpaddlern aus, die sich im Hotel >Zum Kronprinzen< in Hamburg zur Gründung trafen. Ein Gruppenbild zeigt 50 bürgerlich gekleidete Teilnehmer, die man nur teilweise namentlich kennt. Bekanntlich hat es später ja noch einen weiteren Weltkrieg gegeben; das Altarchiv des Verbandes ist 1944 in München bei einem Luftangriff verloren gegangen. Deshalb sind die Kenntnisse darüber lückenhaft.
Warum gründet man einen Verband? Kanusport lässt sich bekanntlich auch außerhalb von Vereinen und Verbänden betreiben, wenn man nicht gerade den Wettkampfsport im Auge hat. Heute mag mancher das nicht annehmen, es ist freilich so. Innerhalb solcher Strukturen tut man sich leichter. Erst recht war das zur Gründungszeit der Fall. Es waren gerade nicht die vermögenden Schichten, die in die Vereine strebten. Und dort Gleichgesinnte, einen Platz im Boot oder im Bootshaus, die Teilnahme an Fahrten und Wettkämpfen und eine zweite Heimat für ihre kärgliche Freizeit fanden. Der DKV versucht seit seiner Gründung, jede in Verein und Verband sinnvolle kanusportliche Betätigung zu fördern und zu vertreten, vom Segeln bis zum Marathon und Drachenboot, sofern das Gerät noch irgendwie in Handarbeit vorwärts bewegt werden könnte. Das ist einer der Gründe, warum ihm selbst in Zeiten des betonten Individualismus (z.B. heute, aber auch in den Jahren nach dem ersten Weltkrieg) eine flächendeckende Erfassung zahlreicher Sportfreunde gelingt. Bestimmte Aspekte des Kanusports waren anfangs nicht von bedenkenfreiem Ruf. Dass solche Kleinboote - wie böse Mädchen - überallhin kommen könnten, wussten Eltern wohl. Für die weite Verbreitung des Kanusports war das schon hinderlich . Der DKV mit seinen Vereinen stand aber nie in dem Ruf, etwa solchen Gefährdungen Raum zu geben. Er gehörte zum bürgerlichen Lager der Gesellschaft. Naheliegende und verwirklichte Form des Zusammenschlusses ist der eingetragene Verein. Als satzungsgemäße Verbandszwecke setzte man fest: 1. Wanderfahrten, 2. Verkehrserleichterungen, 3. Kanustationen, 4. Verkehrsbüros, Bücherei und Kartensammlung, 5. Wettfahrtenbestimmungen und Wettbewerbe, 6. Einwirkung auf die Öffentlichkeit und Behörden – das alles, vor allem Punkt 6, im Jahr 1914!
1918 Nach Kriegsende geht es rapide aufwärts. Überall werden Vereine gegründet. Etliche schließen sich dem DKV an. Es gibt ab 1922 auch einen freien Kanu-Bund im Arbeiter-Turn-und- Sportbund einen Verband Deutscher Wanderpaddler und einen Verband Deutscher Faltbootfahrer. Der ist schon 18 Monate später der Bayernkreis des DKV.
Die Entdeckung von Natur und Landschaft, durch die Wandervögel vor dem Krieg vorgeahnt, ergreift nunmehr weite Kreise der Bevölkerung. Einen Teil davon zieht es naturgemäß auf das Wasser. Der Kanusport als gesellschaftliches Phänomen wird durch technische Entwicklungen begünstigt. Ehemalige Flugzeugwerke bringen gerne Canadiermodelle aus teilweise heute noch aufregenden Baustoffen heraus, z.T. sogar aus Stahl und Leichtmetall. Die Entwicklung brauchbarer gummierter Gewebe macht das Faltboot zu einem käuflichen Wirtschaftsgut. Im Norden ist der Canadier das bevorzugte Boot, im Süden das Faltboot. Die Boote bleiben aber auch als Serienartikel teuer genug. Erst seit etwa 1970 kann ein Kleinboot als für nahezu jeden Haushalt erschwinglich betrachtet werden.
1919 Erster Kanutag und erste deutsche Kanumeisterschaften in Leipzig. Kanutage finden danach häufig zur Jahresmitte statt - später alle zwei Jahre, verbunden mit großen Sternfahrten, Meisterschaften und Belustigungen wie Fischerstechen und dergleichen.
1920 08. Januar - das erste Heft der Verbandszeitschrift "Kanu-Sport" erscheint; sie erscheint bis heute, Unterbrechung nur von November 1944 bis April 1947. Erscheinungsweise teilweise wöchentlich, überwiegend vierzehntägig, derzeit monatlich mit 48 Seiten. Da im amtlichen Teil auch ausgiebig Vereinsnachrichten erscheinen, ist das eine historische Quelle erster Art und Güte. Wegen unterschiedlicher Bezeichnungen (zeitweise "Kanusport- und Faltbootsport", "Kanusport-Nachrichten") in Bibliothekskatalogen schwer zu orten)
1921 Der DKV organisiert sich in Kreisen, die den Einzugsbereichen der Flüsse und Gewässer nachempfunden sind (Donau-Kreis, Oberrhein-Main-Kreis usw).
1923 Im Sommer unternimmt man eine 1. "Nibelungenfahrt" auf der Donau von Ingolstadt nach Wien. Ende des Jahres verzeichnet man 130 Vereine.
1924 Eine Internationale Repräsentantschaft des Kanusports (IRK) entsteht, Wettkampfregeln und Bootsklassen werden festgelegt. Von geschätzten 50.000 aktiven Kanusportlern in Deutschland soll im DKV nur ein geringer Teil organisiert sein. Dieser gründet Kanustationen (ein Netz von Wanderherbergen), besonders das Rügenlager als ständige Einrichtung gewinnt Bedeutung.
1927 Das Gelände für das heute noch existierende Wanderheim am Edersee wird erworben.
Es wird ein "DKV-Industrie-Prüfungsamt" geschaffen. Zweck ist das unvoreingenommene Testen von Booten und jeglichem Zubehör für den Sportbetrieb.
Kanupolo wird neue Wettkampfgattung.
Deutsche Faltbootmeisterschaften mit 58 gemeldeten Booten.
300 DKV-Vereine existieren. Gestritten wird über sinnvolle Bootsabmessungen und Vorschriften dazu. Rennboote damals waren unbezweifelt ästhetisch ansprechend. Das ist heute zweifelhaft.
1928 Eine Arbeitsgemeinschaft der Deutschen Wassersportverbände wird gegründet (AGDW).
DKV-Boote sind vom Registrierungs- und Nummernzwang auf den Wasserstraßen befreit.
Es wird über Maßnahmen gegen Flusssperrungen, Wasserbaumaßnahmen und Flussverschmutzung berichtet. Eine seither unendliche Geschichte. Damals nahezu aussichtslos, weil Baumaßnahmen gerne zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit eingesetzt werden, heute, weil "Naturschutz" auch unsinnige Regelungen zu rechtfertigen scheint und zu allen Zeiten, weil Geld eben die Welt regiert und solches, und nicht nur Wasser, bei Baumaßnahmen und durch Kraftwerke zu fließen pflegt.
1929 Der "Bund Deutscher Wanderpaddler" ist dem DKV angeschlossen, der Hochschulring Deutscher Kajakfahrer ebenso (HDK, gegründet 1927 prominentester Vertreter W. Frentz). Verhandlungen darüber mit der Deutschen Turnerschaft scheitern. Diese fürchtet Übervorteilung und will ihren Wassersportbetrieb selbständig halten.
Nach Satzungsänderungen wird der DKV nunmehr von den Kreisen aus organisiert, er wird zum Dachverband.
Weitere Wanderheime entstehen, es wird Gelände in Urbar bei Koblenz ("Deutsches Eck"), bei der Insel Mainau und bei Osterode erworben. Wanderheime und Zeltplätze werden in den Folgejahren hinzuerworben und ausgebaut. Heute hat der DKV nur noch deren drei (Mainau, Edersee und Waakhausen).
1930 Der DKV gibt einen Auslandsführer mit 150 Flussbeschreibungen heraus, auch ein Jugoslawien-Sonderheft der Verbandszeitschrift mit 16 Flussbeschreibungen.
1931 Man zählt nun 462 Vereine und rund 50.000 Mitglieder. Solche Zahlen sind damals wie heute nur bedingt aussagekräftig. Beitragsehrlichkeit der Vereine und Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit der Mitglieder sind nie ganz zufriedenstellend. Häufig wird in den Veröffentlichungen darüber geklagt. Unausrottbar ist bei Mitgliedern und Vereinen, die Meinung, man habe ja nichts vom Verbandsbeitrag. Es kommen in diesen Jahren Gemeinschaftsfahrten und Zeltlagerstädte mit Hunderten von Teilnehmern zustande. Es gibt auch dubiose Vorgänge, der von 1918 – 1930 Vorsitzender gewesene und im Folgejahr im Alter von nur 52 Jahren verstorbene Franz Reinicke ist wegen des Vorwurfs von Unkorrektheiten zurückgetreten. Der 1931 gewählte neue DKV-Vorsitzende Dr. Max Eckert bleibt bis 1945 im Amt, er wird 1961 nochmals für wenige Monate Vorsitzender (lange Jahre ist er auch Präsident der IRK, nach dem Krieg führende Persönlichkeit im Deutschen Camping Club).
1932 Der Selbstbau von Booten ist Ausdruck der wirtschaftlichen Not, er wird verstärkt gefördert.
1933 bis 1945
Die Gleichschaltung des öffentlichen Lebens trifft auch den DKV, der mit 567 Vereinen in diesen Zeitraum eingeht. Als Opfer kann man ihn nicht so sehr ansehen. Mit den neuen Machthabern gibt es keine unüberwindlichen Schwierigkeiten. Gemäßigt national eingestellt und seit der Gründung unter dem schwarz-weiß-roten Wimpel fahrend, werden zwar die Strukturen angepasst, der Betrieb geht wie gewohnt weiter. Dagegen werden die vereinzelt bestehenden Kanugruppen z.B. der Arbeitervereine aufgelöst, ihr Vermögen wird eingezogen. Aus Vorsitzenden werden Vereinsführer, sie werden ernannt und nicht gewählt, die Kreise werden in elf, später sechzehn Gaue umgesetzt und erhalten römische Ziffern. Kurzfristig besteht ein Deutscher Wassersportverband. Dieser erweist sich aus Sicht der Machthaber bald als überflüssig. Der DKV wird das Fachamt Kanusport im Deutschen Reichsbund für Leibesübungen, seit 01.12.1934 ist jede Form des organisierten Kanusports diesem Fachamt unterstellt. Seinen Namen, sein Personal, seine Vereine und Bootshäuser behält der DKV. Aus der Nationalsozialistischen Organisation heraus bilden sich vereinzelt kanusportliche Gruppierungen. Wasserkampfspiele der Hitlerjugend werden organisiert (1941). Typisches NS-Treiben entsteht innerhalb des DKV in Ansätzen. Massenveranstaltungen mit mehreren tausend Teilnehmern, organisierte Auslands- und Grenzlandgroßfahrten sind beliebt. Die Kraft-durch-Freude Fahrten finden auf dem Wasser und zum Wasser hin ihre Entsprechung. Belanglose Deutschtümelei steht neben Unmenschlichem. Den Vereinen wird der Dietwart verordnet. Das ist ein Funktionär, der das Deutschtum verbreiten soll, es wird die "völkische Aussprache" betrieben und vermutlich mehr ertragen als verinnerlicht. Aber auch der Arierparagraph wird sehr schnell durchgesetzt und befolgt. Jüdische Mitbürger haben keine Heimat mehr im organisierten Kanusport. Wie viele Sportsfreunde davon betroffen waren, ist nicht bekannt. "Patrouillenfahrten" finden statt, wo zuvor Fuchsjagden und ähnliche Geschicklichkeitswettbewerbe veranstaltet wurden.
1934 Der Kanurennsport wird olympische Sportart. Die Spiele 1936 werden daher vom Kanusport aus besonders intensiv vorbereitet. Es beginnen aber die für die große Masse der Mitglieder viel interessanteren Wanderfahrer-Wettbewerbe, die Ursache unermesslich vieler gefahrener Kilometer und befahrener Gewässer sind.
1936 Mit Zehnercanadiern fahren Jugendliche in einer Sternfahrt zum Müggelsee. Der Kanusport spielt im Rahmenprogramm der olympischen Sommerspiele eine große Rolle, spektakuläre Eskimotierübungen werden gezeigt, das internationale Jugendlager zählt 3.000 Bewohner aus 15 Nationen. Aus neun olympischen Wettbewerben werden zwei Gold, drei Silber und zwei Bronzemedaillen erreicht. So ganz zufrieden ist man damit nicht.
Kaum sind die Spiele vorbei, werden die Jugendabteilungen der Vereine bis zum Alter von 14 Jahren aufgelöst und dem Jungvolk der Hitlerjugend angegliedert.
1937 Der Kanuslalom kommt als im Verband betriebene Sportart hinzu.
1938 Es gibt schätzungsweise 500 Bootshäuser, 1.128 Vereine mit 44.129 aktiven und rund 200.000 nicht organisierte Kanusportler in Deutschland. Der Österreichische Kajakverband wird aufgelöst und als Gau XVII übernommen.
1939 Der Reichsbund für Leibesübungen gilt nunmehr als Untergliederung der NSDAP mit der Bezeichnung NSRL, Nationalsozialistischer Reichsbund für Leibesübungen.
Rennklassen für Frauen bei den Deutschen Meisterschaften werden eingeführt.
Mit Kriegsbeginn verschlechtern sich die Bedingungen für die Verbandsarbeit kriegsbedingt. Der organisiert betriebene Sport dient der Ertüchtigung und Stimmung, also wird er weiterhin gefördert. Es finden Kriegsmeisterschaften, Lehrgänge, verstärkt auch für Frauen, Skikurse und selbst Wassersport-Volkstage statt, z.B. im Sommer 1943 mit 231 Vereinen und 3.122 Booten. Wegen der Sparmaßnahmen der totalen Kriegführung werden die Fachämter Rudern und Kanusport vereinigt, ebenso die Verbandszeitschrift. Diese heißt jetzt "Wassersport" und erscheint noch bis zum September 1944.
1945 Alle Bestandteile der NS-Organisation werden mit Kriegsende durch die Alliierten aufgelöst, das betrifft auch den DKV.
Im Oktober wird von einer überörtlichen Regatta in Wuppertal berichtet (Vorberg, der spätere DKV-Vorsitzende hat sie organisiert.
1946 – 1960
1946 In der britischen Zone finden Kanuregatten in Duisburg, Essen und Wuppertal statt. Es ist wieder Otto Vorberg (Vorsitzender 1949 - 1961), der die Genehmigungen bei der Militärregierung beantragt.1947 Es erscheint zunächst hektographiert ein "Kanusport-Nachrichtenblatt". In dem Jahr finden ein Slalomwettbewerb, ein Städte Kanu-Wettkampf und 1. Deutsche Kanumeisterschaften in Düsseldorf und Duisburg statt.
1949 Der DKV wird am 19. März in Kassel wieder gegründet. Den Vorsitz übernimmt Otto Vorberg. Der Bereich des DKV beschränkt sich umständehalber zunächst auf die amerikanische und britische Zone in Westdeutschland. Der DKV wird als Dachverband seiner Landesverbände gestaltet. Die Entwicklung folgt der Politik. Der Dachverband ist allerdings wesentlich ärmer und schwächer als die Landesverbände.
Zwischenfrage: Hat es so etwas wie Vergangenheitsbewältigung innerhalb des DKV gegeben? Antwort: Nein, eine solche Frage hätte die Gefragten wie üblich erstaunt bis empört. Weitere Zwischenfrage: Hätte es sie denn geben müssen? Antwort: Jein. Im Rahmen einer solchen Darstellung kann das Thema nicht seriös behandelt werden. Wenige Stichworte von einem Spätgeborenen, der seit Jahren darüber arbeitet: So richtige Übeltäter und Untaten sind innerhalb des DKV nach 1933 nicht feststellbar; 1933 war die Begeisterung schon deutlich, eine andere Darstellung wäre blauäugig. Prominente Kanusportler in NS-Positionen hat es nicht gegeben. Weithin bekannt ist nur Walter Frentz, der Filmemacher und "Kameramann des Führers"; er war als NS-Vertreter nicht eigentlich bedeutend und hatte nach 1933 auch keine Funktion im DKV. Dia- und Filmvorträge hat er danach häufig veranstaltet und sich als Natur- und Gewässerschutzfachmann durchaus profiliert. Gestritten hat man z.B. nach 1945 um Farbe und Form des Standers. Schwarz-weiß-rot wurde ernstlich gefordert, blau-weiß-rot ergab sich als Kompromiss (und hat sich so und im Design wie seit 1914 unverändert erhalten).
1950 Der DKV wird in die ICF, die International Canoe Federation aufgenommen (endgültig erst 1952).
1952 Bei den olympischen Spielen in Helsinki nimmt man mit zehn Sportlern teil und erntet drei Bronzemedaillen.
1955 Momentaufnahmen: 40.000 Mitglieder und 614 Vereine. Im März erhält Dr. Eckert, seit 1953 Ehrenvorsitzender, Sitz und Stimme im Vorstand, das Amt des Pressewarts wird gestrichen (die Geschäftsstelle erledigt das mit), bei Wildwasserrennen und Slalomweltmeisterschaften im Juli werden riesige Erfolge erzielt. Beklagt wird die geringe Resonanz. Für die Unterrichtung der Medien ist niemand zuständig.
1956 Der saarländische Kanu-Bund ist offizielles DKV-Mitglied. In Melbourne werden mit wiederum zehn Athleten einmal Gold, zweimal Silber und einmal Bronze erreicht.
In den Folgejahren prägen Gewässerbau, Gewässerverschmutzung und finanzielle Querelen innerhalb des Verbandes das Bild. Als gelegentliche Erfolge erlebt man Bootsschleusen und Bootsgassen
1959 Als amtliches Jahrbuch erscheint "Deutscher Kanu-Verband 1914 - 1959, 10 Jahre Wiederaufbau" (176 Seiten).
1961 - 1964
Diese Jahre wurden von dem Chronisten Obstoj als Krisenjahre bezeichnet. Über die Ursachen könnten, oder besser sollten, noch Bücher geschrieben werden, weil sehr lehrreich. (Geldfragen, ein im Schlamm untergegangener Kanutag am Chiemsee, NRW-Übergewicht, Deutsch-Deutsche Probleme, Kampfabstimmungen, mehrfacher Umzug der Zentrale, Vermengung mit Dr. Eckerts Deutschem Campingclub, gerichtliche Notvorstandsbestellung als Stichworte).
1964 Das 50jährige Jubiläum, eine weitere Festschrift hierzu erscheint.
1965 – 1989
Wie bei jeder Darstellung der neueren Geschichte erscheinen dem Schreiber die Einzelereignisse immer belangloser. Das Kunststoffboot setzt sich in allen Bereichen durch. Ab 1969 gibt es erst wieder Kanupoloturniere. Bis 1964 treten gesamtdeutsche Mannschaften bei olympischen Spielen an. Die Verbauung der Flüsse geht weiter, es bessert sich nach einem Tiefpunkt seit Mitte der Siebziger ganz allmählich die Wasserqualität und schon beginnen auch die naturschutzbedingten Behinderungen und Sperrungen. Der DKV-Beitrag, der pro Mitglied und Jahr an den Dachverband abzuführen ist, steigt 1971 von DM 4,50 auf DM 6,00, der Jahresetat liegt bei DM 937.500, davon verschlingen die Heime und Zeltplätze DM 140.000,00. Nach der Struktur des DKV sind diese eigentlich bei dem Dachverband verfehlt angesiedelt, beanspruchen Geld und personelle Kapazität und helfen den Bedürfnissen der zahlenmäßig weit überwiegenden Wanderfahrer doch kaum weiter. Vielleicht wichtiger sind das immer neu aufgelegte Flusswanderbuch sowie die verschiedensten Auslands- und Regionalführer. Einen festen Platz neben den Flussführern haben die seit 1983 erscheinenden "Kanu"-Kalender sowie der später hinzugekommene "Kanu-Alpin"-Kalender im Posterformat. Der Kanuslalom ist 1972 olympische Sportart, seit 1992 regelmäßig dabei. In den Wettkampfsportarten sind die Erfolge naturgemäß unterschiedlich, 1976 in Montreal bleibt man ohne Metall. 1980 nimmt der Geschäftsführer Wolfgang Over seine Arbeit auf, 1981 wird Ulrich Feldhoff zum Präsidenten gewählt, beide noch heute im Amt, Feldhoff ist nun auch Präsident der ICF. (Geschäftsführer gab es ganz wenige, z.B. Grete Erlwein von 1931 - 1945, Hans Egon Vesper 1951 - 1981, Wolfgang Over seither - kürzere Amtszeiten der Vorsitzenden sind eigentlich nur in den erwähnten Krisenjahren zu vermerken. Darüber kann man - ohne jede Wertung - seine Gedanken anstellen).1989 begeht man nochmals ein Jubiläum, diesmal 75 Jahre. Es erscheint eine Festschrift 75 Jahre Deutscher Kanu-Verband e.V. (Verfasser Obstoj, ohne bei diesem abschreiben zu können, hätte die vorliegende Zusammenstellung Jahre benötigt). Auch erscheint ein Buch über das Kanuwandern in Deutschland - Die Geschichte des Wasserwanderns im DKV- von Heinz A. Oehring, sehr gehaltvoll – in der Wertung von NS-Aspekten etwas unglücklich.
Wende und jüngste Vergangenheit
Entsprechend der politischen Entwicklung geht der DKSV, der Deutsche Kanu Sport Verband der DDR, Anfang 1990 schnell im DKV auf, die neuen Landesverbände entsprechen der politischen Gliederung. Im Westen ist das bis heute nicht durchgängig der Fall. Man darf erwähnen, dass die seit Jahrzehnten, besonders bei der jährlichen TID, der internationalen Donaufahrt, geknüpften Kontakte ein wenig beigetragen haben, den Ostblock zu >unterwandern< und wechselseitig menschliches Verständnis zu wecken. DKV-Sportler nehmen offiziell seit 1965 an dieser seit 1958 jährlich stattfindenden legendären Großfahrt teil. Bei den olympischen Spielen 1992 und 1996 wird Metall in beispielloser Weise erkämpft, 2000 schon wieder weniger, immer dabei Birgit Fischer. Keiner der erfolgreichen Wettkämpfer kann Reichtümer ansammeln. Vor der Wende waren etwas unter 100.000 Mitglieder verzeichnet, heute liegt die Zahl um 112.000; nur etwa ein Zehntel davon bezieht die Verbandszeitschrift. Die Zahl der Vereine soll bei 1300 liegen. Der Haushalt liegt bei 5,2 Mio DM. Davon laufen rund 70% eigentlich nur durch (dies ist etwa der Anteil des olympischer Spitzensports, für den öffentliche Mittel vereinnahmt werden). Wirklich von den Mitgliedern stammen rund 1,1 Mio DM, 0,6 Mio DM erwirtschaftet der DKV anderweitig. Was soll man zu solchen Finanzmitteln sagen? (Vielleicht gibt es noch Dörfer in Deutschland, deren Haushalt kleiner ist). Dabei ist Kanusport, auch bezogen auf den privaten Haushalt, eine der preiswertesten Sportarten. Neuerdings kann man Kanusport nicht nur privat mit eigenem Gerät organisieren, man kann auch Boote mieten oder die Teilnahme an Reisen und Touren kaufen und Informationen jederzeit nahezu kostenfrei beziehen.
1997 meldet der DKV mit www.kanu.de seine Präsenz im Internet an
1998 erscheint der Altklassiker, das Deutsche Flusswanderbuch, ehemals Zelt- und Flußwanderbuch in seiner 24. Auflage. Diese Tradition besteht seit 1927. Ungebremst ist im Zeichen der Konsumgesellschaft die Erwartungshaltung von Mitgliedern und Nichtmitgliedern gegenüber dem DKV, der mittlerweile Hunderte von Sperrungen und Reglementierungen von Gewässern registrieren muss und mit seinen Vereinen und Verbänden und erst recht seiner Handvoll Mitarbeiter für jedes Problem eine Lösung bieten soll. Umweltsymposien und Gutachten, Kooperation auf verschiedensten Ebenen sollen Abhilfe schaffen. Kein heiliger Schauer entsteht, wenn das Mitglied die Buchstaben DKV hört oder liest, ein wohliges Gefühl dagegen, wenn es an die Gastfreundschaft bei auswärtigen Vereinen denkt. Über den DKV als Dachverband wird viel geschimpft und räsoniert. Alternativen? Ja, die Geschichte hat noch nie Patentrezepte geliefert.
Eine abschließende Feststellung gerät leicht pathetisch, bombastisch oder nebulös. Belassen wir es dabei, dass der immer vielseitig und meist flexibel gewesene DKV bald 100 Jahre auf dem Buckel haben und wohl nicht klein zu kriegen sein wird.